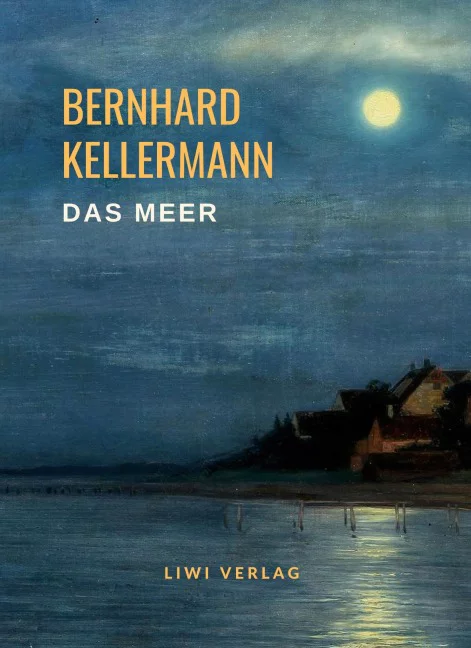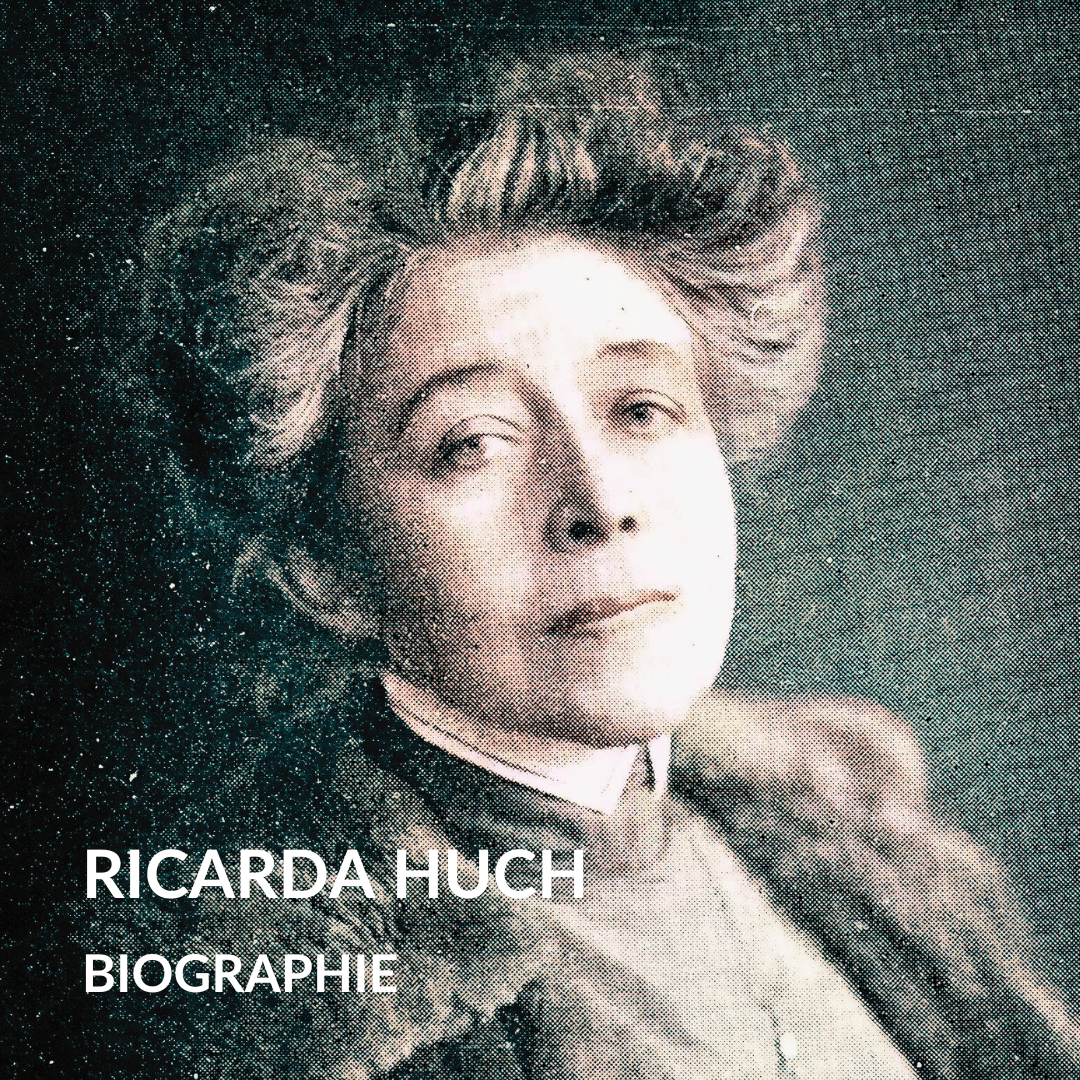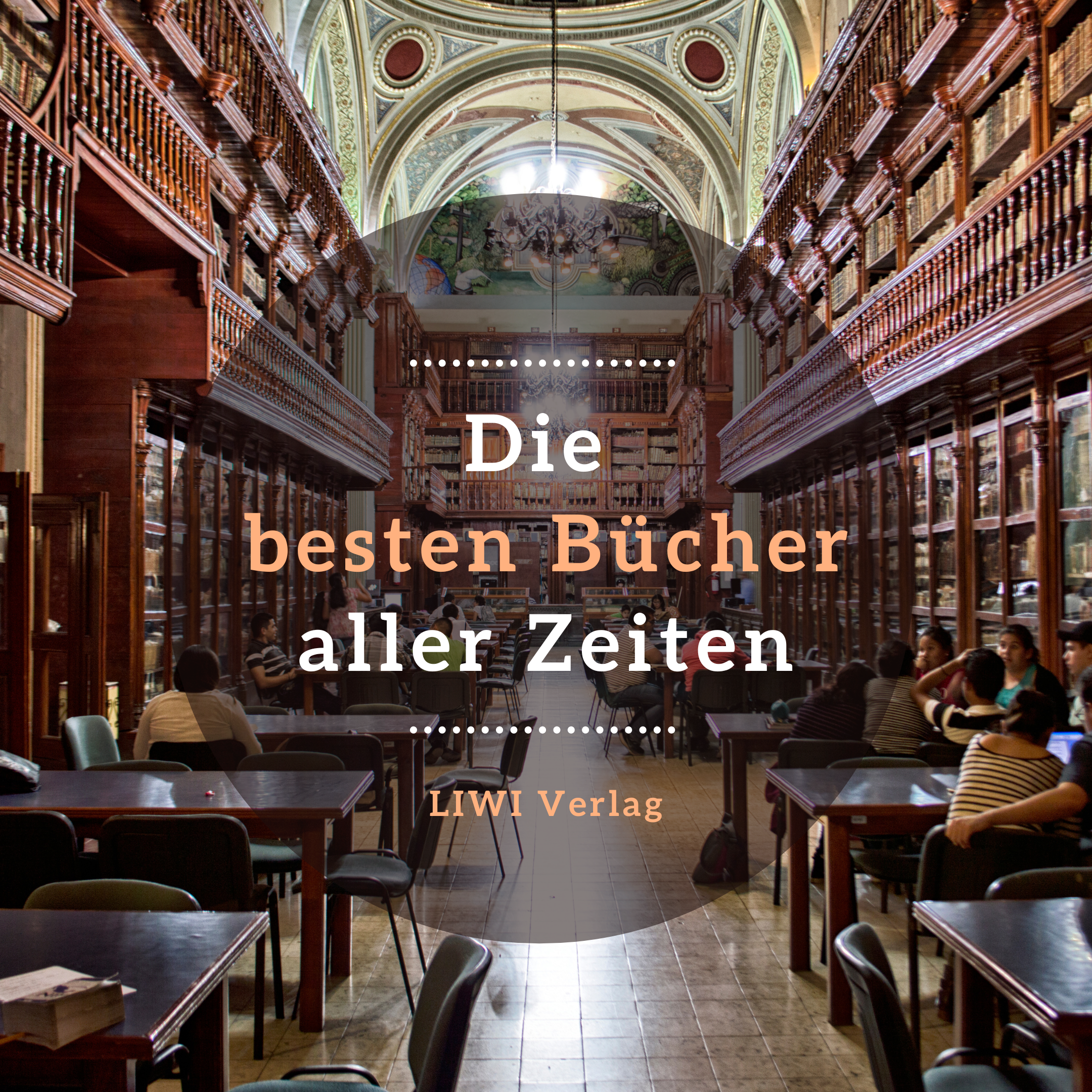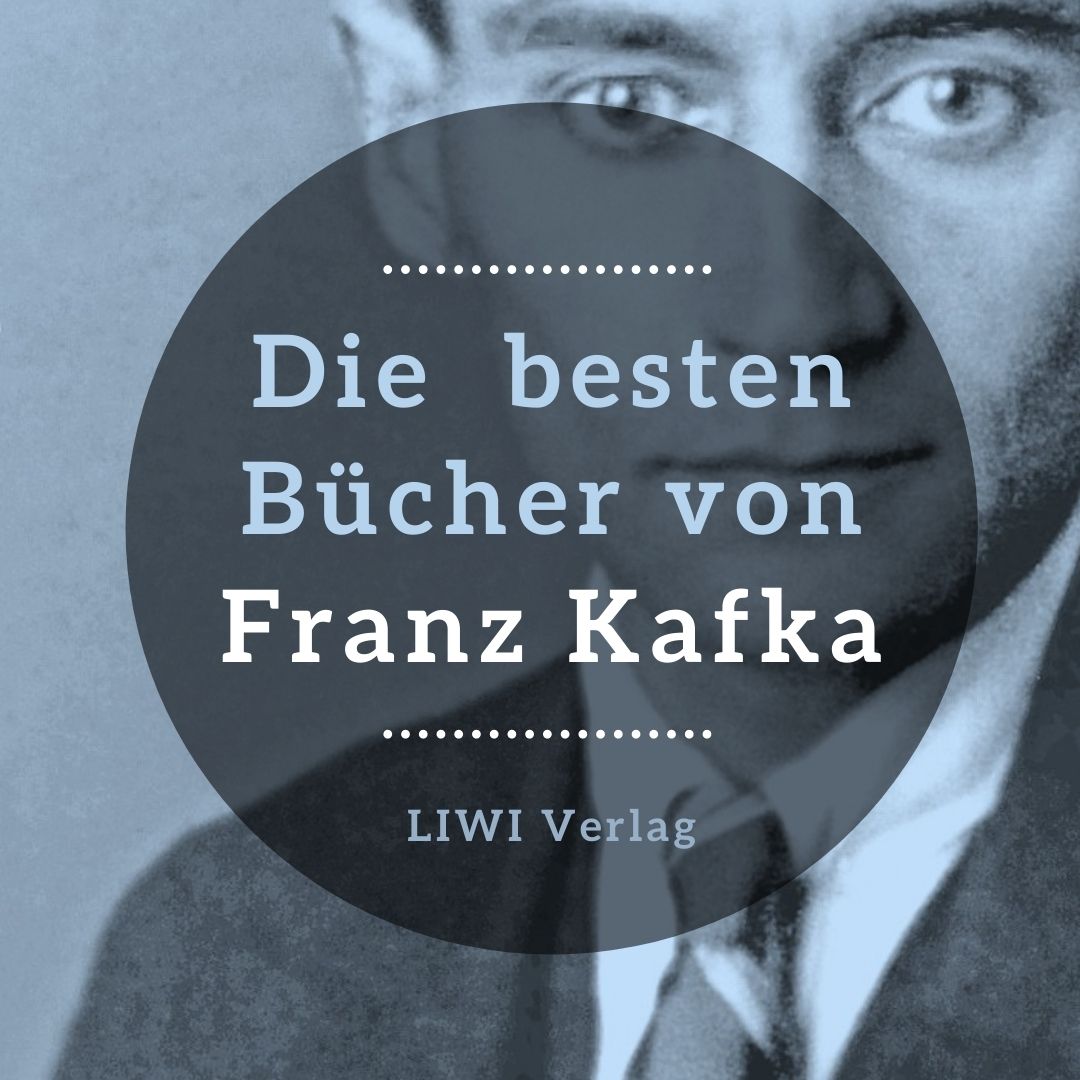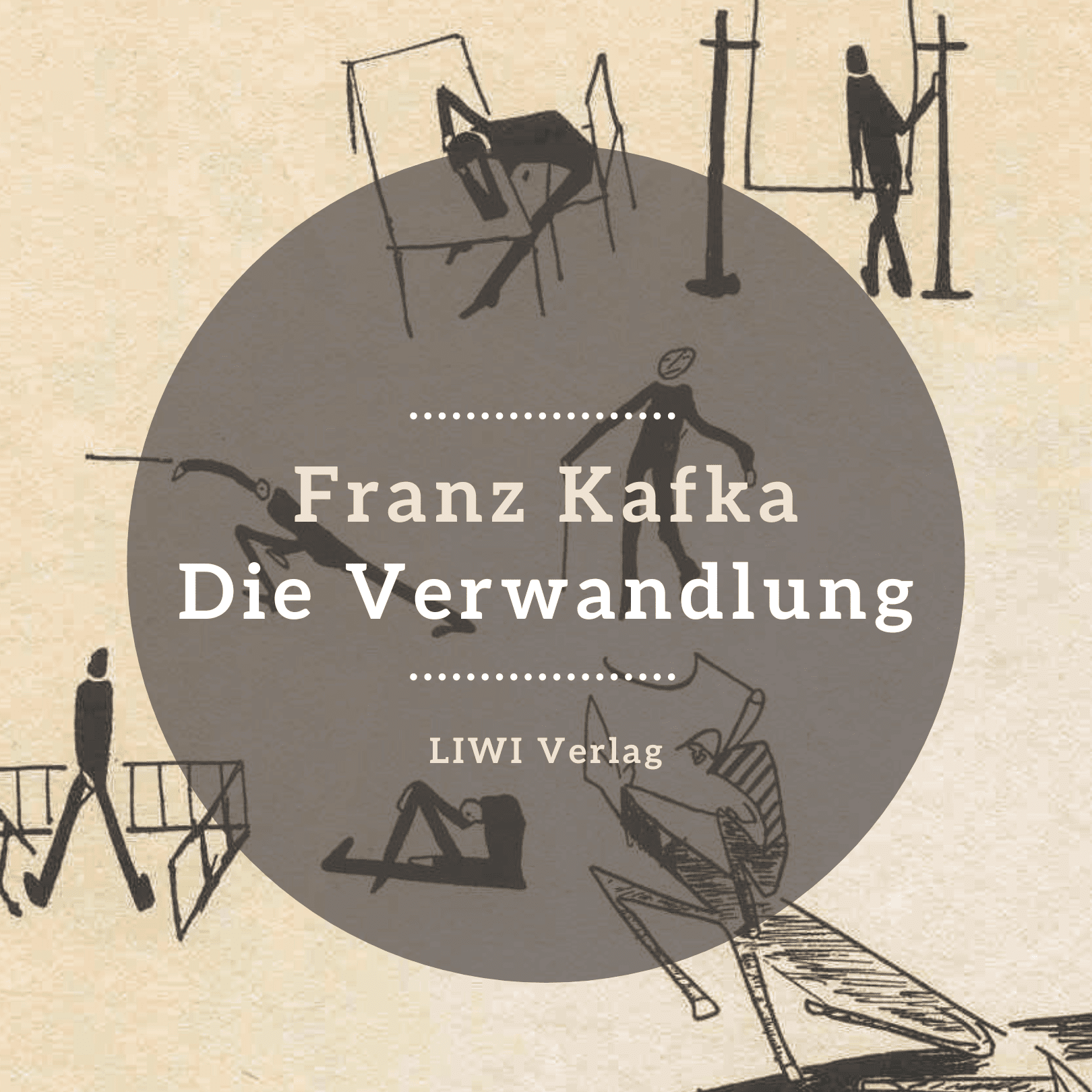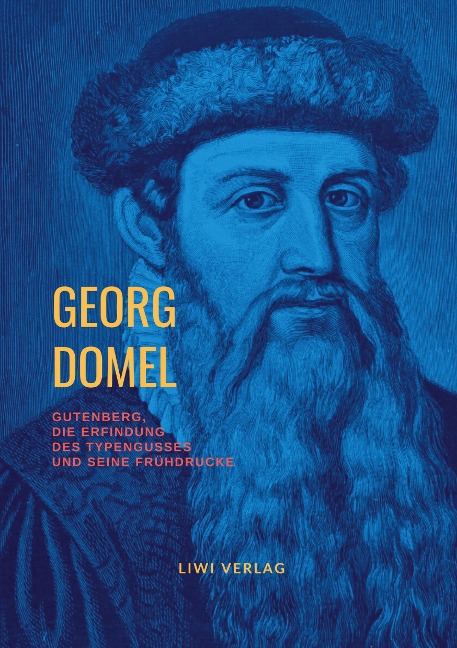
Gutenberg, die Erfindung des Typengusses und seine Frühdrucke
Aus dem Inhalt:
Vorläufer des Buchdrucks.
Johannes Gutenberg.
Zeugnisse und Urkunden.
Stempel, Matern und Guß.
Von der Satztechnik.
Von der Drucktechnik.
Die Frühdrucke Gutenbergs.
Georg Domel.
Gutenberg, die Erfindung des Typengusses und seine Frühdrucke.
Erstdruck: Privatdruck, Köln 1919.
Durchgesehener Neusatz, diese Ausgabe folgt:
Verlag von Heinrich Z. Gonski, zweite, durchgesehene Auflage, Köln 1921.
Neuausgabe, LIWI Verlag, Göttingen 2020.
LIWI Literatur- und Wissenschaftsverlag.
Leseprobe:
Auch bei der Erfindung der Buchdrucktechnik dürfen wir uns – wie bei den meisten Erfindungen – nicht vorstellen, daß der Erfinder darauf ausgegangen ist, den Buchdruck etwa so auszubilden, wie er sich uns heut darbietet. Der Schöpfer mag zunächst im Auge gehabt haben, einen Ersatz für die teuren, geschriebenen Bücher zu schaffen. Es mag ihn dabei der Gedanke geleitet haben, die Vervielfältigung auf dem naheliegenden Wege des Druckes zu erreichen; denn die Blockbücher und andere Einblattdrucke jener Zeit konnten auf einen Geist, wie den Gutenbergs, nur anregend wirken. Bald mußte er finden, daß das Verfahren unzureichend und umständlich sei, daß es der Verbesserung bedürfe. Während die Blockbücher und die Einblattdrucke mit Hilfe des Reibers entstanden, diese Original-Holz-Schnitte also eigentlich nicht gedruckt, sondern abgerieben wurden, mußte der Druck einer aus Einzeltypen zusammengesetzten Seite, weil diese unhantierbar, unter Anwendung eines anderen Verfahrens erfolgen, d. h. das Papier mußte auf den Satz gelegt und ein Abklatsch genommen werden. Diese Umwälzung des Druckverfahrens bot Gutenberg allein schon Veranlassung zur Betätigung und Neuschöpfung; jedenfalls war er der richtige Erfindertyp, zäh und ausdauernd, der auch hier nicht eher ruhte, bis er diese Schwierigkeit – wie so viele andere – überwunden hatte. Und die Erfindung der Presse hätte uns seine schöpferische Veranlagung allein schon bewundern lassen.
Aber der Erfinder war nicht nur der geniale Schöpfer eines neuen Verfahrens, das zur Vervielfältigung dienen sollte, sondern er war auch ein Künstler, das beweist sein Werk vom Anbeginn des Entstehens. Und daß er auch Geschäftsmann war, was ihm so viele Forscher absprechen möchten, beweist er öfters: so bei der Feststellung der Bedingungen, unter denen er mit seinen Straßburger Gesellschaftern arbeitete, bei dem energischen Eingreifen dem Mainzer Rat gegenüber und in andern Fällen.
Was uns über Gutenberg an verbürgten Nachrichten erhalten geblieben ist, ist zwar wenig, doch bietet es immerhin Unterlagen genug, uns ein Bild vom Erfinder und seinem Lebenswerk zu hinterlassen, von der Wichtigkeit und dem Wert seiner Erfindung sowie der Tragik seines Loses, ohne daß wir zur Phantasie die Zuflucht nehmen müßten.
Johannes (Gutenberg) zum Gensfleisch (Henne zur Laden) stammt aus Mainz. Bestimmte Anhaltspunkte über das Geburtsjahr des Erfinders fehlen; man kann annehmen, daß das Jahr 1400 uns den großen Mann schenkte, der die bedeutungsvollste Erfindung aller Zeiten machte. Seine Tätigkeit reichte bis 1467, im Jahre 1468 muß Gutenberg als gestorben gelten; wenigstens geht dies aus der Urkunde des Dr. Humery hervor, nach der die Nachlassenschaft Gutenbergs durch den Erzbischof Adolf von Mainz an Dr. Humery ausgeliefert wird. Gutenberg starb kinderlos; daß er verheiratet war, ist zu bezweifeln. Ennelin zu der eisern Türe wird als seine Ehefrau von manchen Forschern angesehen, doch liegt keine Bestätigung dieser Annahme vor. Sie mag Ansprüche an Gutenberg gehabt haben; Genaueres ist bis heut noch nicht darüber gefunden worden. Gutenbergs Vater hieß Friele zum Gensfleisch, genannt zur Laden, zu Gutenberg, der von 1372-1419 bekannt ist und mit Elsgen Wyrich, gestorben um 1433, in zweiter Ehe verheiratet war. Gutenbergs Großvater hieß ebenfalls Friele zum Gensfleisch, genannt zum Eselweck, zur Laden, der etwa 1356-1372 in den Akten vorkommt und in zweiter Ehe mit Grete zur jungen Aben († 1404) verheiratet war; aus dieser zweiten Ehe stammte Friele, der Vater Gutenbergs. Der Großvater Gutenbergs, Friele, stammt seinerseits wieder aus einer zweiten Ehe, die sein Vater, Petermann zum Gensfleisch (1332-1370) mit Nese, Tochter Petermanns zum Eselwech einging, dessen Vater, Friele zum Gensfleisch, genannt Rafit – der Ahnherr der Familie – von 1330-1352 in den Akten nachweisbar ist und Ratsherr von Mainz war. Dieser Ahnherr, Friele zum Gensfleisch (Rafit oder Ravit bedeutet Streitroß, arabisches Roß), war ebenfalls zweimal verheiratet: in erster Ehe, aus welcher der oben genannte Petermann stammt, mit einer Unbekanntem in zweiter Ehe mit einer Witwe von Oppenheim (geborenen von Sorgenloch), daher fährt die Linie wohl auch den Beinamen von Sorgenloch und muß von der andern Linie auseinandergehalten werden; sie ist nachweisbar bis 1587.
Der Vater des Erfinders hieß demnach Frielo (Frielo, Kosename für Friedrich) Gensfleisch, entstammte einer angesehenen Mainzer Patrizierfamilie und war verheiratet mit Else Wyrich, der Tochter eines Rentmeisters. Mit ihr erlosch der Name und die Familie Wyrich. Sie brachte als Erbteil von ihrem Vater einen Teil des Hofes »zum Gutenberg« ein, der zum andern Teile dem Geschlecht »zum Jungen« gehörte. der Ehe der Genannten, Friele und Else, entsprossen zwei Söhne, Friele und Johann, von denen der zweite der Erfinder der Buchdruckerkunst ist. Er nannte sich später kurz Gutenberg. Über die Jugend des Erfinders ist uns leider gar nichts bekannt.
Mainz hat vom Anfang bis zur Mitte des 15. Jahrh. bewegte Zeiten durchgemacht: viele innere, die Verwaltung betreffende Kämpfe und später durch die Erzbischöfe heraufbeschworene, schwere Zerwürfnisse. Es wanderten wiederholt Patrizier aus, weil sie sich mit der Herrschaft der Bürger nicht einverstanden zu erklären vermochten; unter diesen auch Georg Gensfleisch zum Sorgenloch und mit ihm die ganze Familie· Später durften einige von den ausgewanderten Patriziern wieder in die Vaterstadt zurückkehren, nur Georg Gensfleisch war ausgeschlossen. Henchen zum Gudenberg (Johannes Gutenberg) kehrt ebenfalls später wieder nach Mainz zurück. Ob er aus andern Gründen als politischen die Stadt verlassen haben mag, ist nicht sicher festzustellen; es ist immerhin anzunehmen, denn er war noch jung, als sich die Zünfte und die Geschlechter der Stadt bekämpften; seine politische Betätigung ist allerdings kaum als erwiesen zu betrachten. Der Sühnevertrag (die Rachtung) vom 28. März 1430 beweist jedenfalls, daß Henchen zum Gudenberg, als einer durch Namensnennung festgestellten Gruppe von Adligen die Rückkehr in die Stadt gestattet wurde, auch unter den Bevorzugten ist. Von der Erlaubnis macht Gutenberg zunächst keinen Gebrauch, denn eine weitere Urkunde vom l4. März 1434 bestätigt uns, daß er zu jener Zeit noch in Straßburg weilt. Diese Urkunde besagt, daß Gutenberg einen Stadtschreiber von Mainz, namens Nikolaus von Werkstatt, verhaften und festsetzen ließ, weil ihm 310 Gulden rückständiger Rente von der Stadt Mainz nicht bezahlt waren. Der Schreiber mußte sich dafür verbürgen daß die rückständige Zahlung an Ort Gelthus, einen Verwandten Gutenbergs, zu erfolgen habe, und Gutenberg ließ den Schreiber aus Vermittlung des Rates der Stadt Straßburg frei und verzichtete sogar auf die Schuldsumme »der Stadt zu liebe und Ehre«. Gutenberg handelte hier klug und wohlüberlegt, denn um die Stadt Straßburg, deren Schutz er genoß, nicht in Unannehmlichkeiten zu bringen, gab er nach und hatte später die Genugtuung, zu sehen, daß Mainz nachholte, was es versäumt, und bezahlte.
Daß Gutenberg während der nächsten Jahre noch in Straßburg weilt, geht aus einer Reihe von Urkunden hervor, wie aus einem Abkommen mit der Stadt Mainz wegen einer Rente von seinem Bruder Friele, aus Eintragungen in den Rechnungsbüchern der Stadt Straßburg, aus einer Bürgschafts-Erklärung seitens Gutenberg und aus den Prozeßakten vom Jahre 1439. Diese Prozeßakten geben uns einen Einblick in Gutenbergs Geschäfte und seine Betätigung mit technischen Arbeiten während seines Straßburger Aufenthalts, der von größter Bedeutung ist.
Bestellen Sie mit einem Klick*:
Buchempfehlungen – Listen zum Stöbern:
- Buchempfehlungen: Die besten Bücher aller Zeiten
- 100 Bücher – Die neue ZEIT-Bibliothek der Weltliteratur
- Lieblingsbücher der Briten: BBC Big Read
- Die 100 Bücher des Jahrhunderts von Le Monde
- Der Kanon: Die deutsche Literatur. Reich-Ranickis Liste
- Liste der 100 besten englischsprachigen Romane
- Die besten Bücher von Frauen – Die Kanon – Sybille Berg
- Die besten Bücher 2024
- Liste der 100 besten englischsprachigen Romane
- Die Zeit Bibliothek der 100 Bücher (1980)
- BBC-Auswahl der 100 bedeutendsten britischen Romane
- Schecks Kanon – Die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur
- BBC-Auswahl der 20 besten Romane von 2000 bis 2014
- Elke Heidenreich: Buchtipps & Lieblingsbücher
- Christine Westermann Buchtipps
- Das Literarische Quartett Bücherliste
„Die besten Bücher“ – Auswahl des LIWI Blogs:
- Die besten Bücher von Edgar Allan Poe
- Die besten Bücher von Stefan Zweig
- Die besten Bücher von Fjodor Dostojewski
- Die besten Bücher von Franz Kafka
- Die besten Bücher von Jack London
- Die besten Bücher von Heinrich Heine
- Die besten Bücher von E. T. A. Hoffmann
- Die besten Bücher von Daniel Defoe
- Die besten Bücher von Heinrich Mann
- Die besten Bücher von Joseph Roth
- Die besten Bücher von Rudyard Kipling
- Die besten Bücher von Eduard von Keyserling
- Die besten Bücher von Else Lasker-Schüler
- Die besten Bücher von Arthur Schnitzler
- Die besten Bücher von Gustave Flaubert
- Die besten Bücher von Hans Fallada
- Die besten Bücher von Joseph Conrad
- Die besten Bücher von Novalis
- Die besten historischen Romane
- Die besten Bücher gegen Rechts
- Die besten Bücher für den Sommer
- Die besten Kinderbücher
- Die besten Gedichte von Rainer Maria Rilke
- Die wichtigsten Literaturepochen
- Was ist ein Klassiker?
„Literaturpreis – Gewinner“: