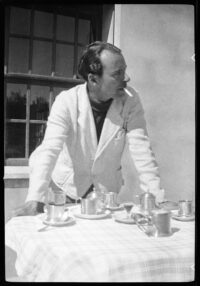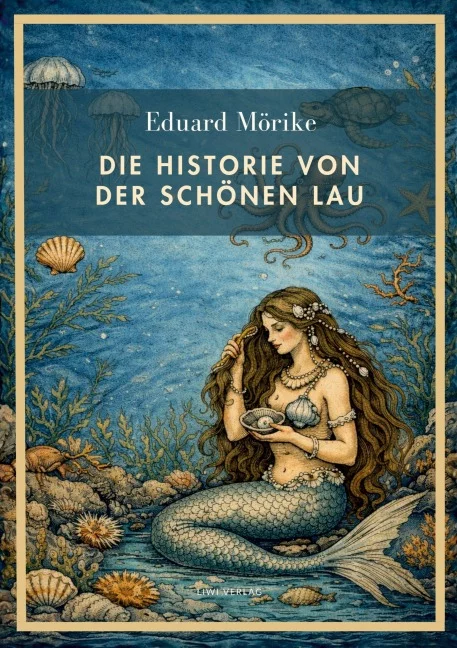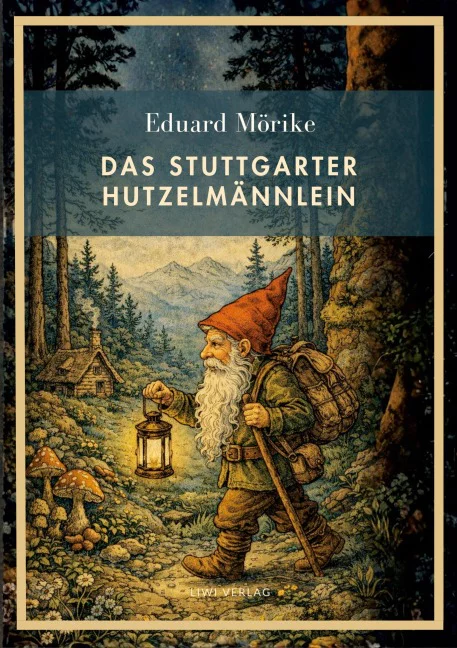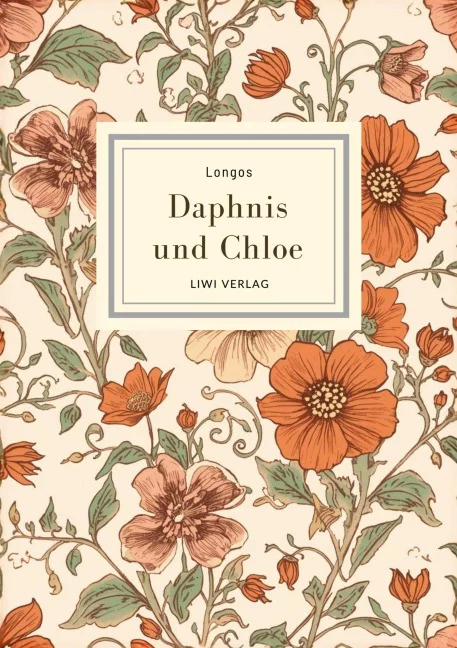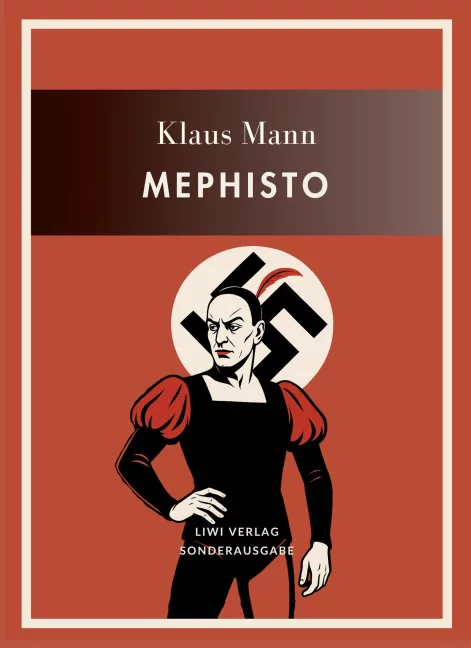
Mephisto
„Man weiß ja, daß die großen Herren Sympathie haben für Komödianten.“
Zitat aus Mephisto von Klaus MannKlaus Manns Roman erzählt die Geschichte des Schauspielers Hendrik Höfgen, der nach 1933 durch Anpassung und taktische Loyalität zum gefeierten Künstler des Regimes aufsteigt. Mephisto gilt als einer der einflussreichsten Romane der Exilliteratur und zeichnet das Bild eines Künstlers, der zum „Clown zur Zerstreuung der Mörder“ wird – und daran innerlich zerbricht.
Buch bestellen
(Anzeige / Affiliatelink)*
Übersicht: Das Wichtigste in Kürze
- Autor: Klaus Mann
- Titel: Mephisto. Roman einer Karriere
- Gattung: Roman
- Veröffentlichung: 1936 (im Exilverlag Querido in Amsterdam)
- Epoche: Exilliteratur
- Wichtige Figuren: Hendrik Höfgen; Barbara Bruckner; Juliette; der General; Prof. Bruckner; Theophil Marder
- Inhalt in einem Satz: Der Roman verfolgt die Karriere des Schauspielers Hendrik Höfgen, der sich im nationalsozialistischen Deutschland durch Opportunismus nach oben dient.
- Wissenswertes: Als Vorbild für die Figur des korrumpierbaren Künstlers dient unverkennbar der Schauspieler Gustaf Gründgens. Obwohl Klaus Mann abgestritten hatte, einen „Schlüsselroman“ geschrieben zu haben, wurde dieses Buch 1966 in Deutschland gerichtlich verboten. Erst 1981 konnte es im Rowohlt Verlag erneut erscheinen. Heute sind verschiedene Buchausgaben erhältlich, z. B. im LIWI Verlag.
Mephisto – Video aus Faust mit Gustav Gründgens als Mephistopheles
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mephisto – Zusammenfassung / Inhaltsangabe
Einleitung
Hendrik Höfgen, ein ehrgeiziger Schauspieler aus Hamburg, startet in den 1920er-Jahren mit kleinen Rollen an Provinzbühnen. Er arbeitet verbissen an Karriere und Technik, bewegt sich im politisierten Künstler-Milieu der Weimarer Republik und sympathisiert zeitweise mit linken Ideen. Seine Wandlungsfähigkeit auf der Bühne wird zum Markenzeichen – und zur Voraussetzung seiner späteren problematischen Laufbahn.
Aufstieg und Anpassung
Nach der Machtübernahme 1933 passt sich Höfgen dem neuen Regime Schritt für Schritt an. Öffentliche Bekenntnisse vermeidet er, pflegt aber nützliche Kontakte und nutzt die veränderte Theaterpolitik für seinen Aufstieg. Private Beziehungen leiden darunter: frühere Partnerinnen wie Nicoletta von Niebuhr distanzieren sich; die Ehe mit Barbara Bruckner gerät unter Druck. Höfgen orientiert sich zunehmend an einflussreichen Protektoren.
Moralische Konflikte
Höfgen wird zum Liebling des Generals (Göring-Spiegelbild) und erhält prestigeträchtige Aufgaben. Der Preis sind Loyalitätsbrüche: Er lässt frühere Weggefährten wie Otto Ulrichs zurück, nimmt Rücksicht auf die Erwartungen der Macht und entfremdet sich von Barbara und deren Vater, dem Geheimrat/Prof. Bruckner. Zwei Frauen markieren seine inneren Spannungen: Dora Martin, internationaler Star, sucht Distanz zum Regime und wird zum Gegenbild; Juliette Martens bindet ihn in einer privaten, ambivalenten Beziehung, die seine Abhängigkeiten sichtbar macht.
Höhepunkt und Fall
Als Höfgen Mephisto in Goethes Faust spielt, erreicht er den künstlerischen Höhepunkt – die Rolle spiegelt seinen opportunistischen Pakt mit der Macht. Mit dem Ruhm wachsen Angst und Isolation: Freunde sind im Exil oder tot, sein Erfolg hängt von der Gunst des Generals ab. Am Ende steht ein äußerlich gefeierter, innerlich erschöpfter Künstler, dessen Karriere auf Anpassung, taktischem Schweigen und Verrat gründet – und der darüber persönlich und moralisch zerfällt.
Mephisto – Wichtige Charaktere (Hauptfiguren)
Hendrik Höfgen
Zentralfigur: ehrgeiziger Schauspieler, der vom Weimarer Provinztheater zum Vorzeigekünstler des NS-Staates aufsteigt. Seine Karriere beruht auf opportunistischer Anpassung, taktischem Schweigen und Loyalitätsbrüchen.
Der General
Mächtiger Förderer Höfgens (Spiegelfigur zu Göring). Verkörpert die Verflechtung von Kunst und Macht; über ihn erhält Höfgen Rollen, Positionen und Schutz – bei politischer Gefolgschaft.
Barbara Bruckner
Höfgens Ehefrau. Zwischen Zuneigung und moralischer Distanz hin- und hergerissen; an ihr zeigt der Roman die privaten Kosten von Höfgens Anpassung.
Geheimrat/Prof. Bruckner
Barbaras Vater, Vertreter eines gebildeten, bürgerlichen Ethos. Dient als moralischer Gegenpol zu Höfgens Karriereverständnis und als Maßstab für Verantwortung.
Dora Martin
International gefeierter Star. Ihre Distanz zum Regime und ihre Professionalität setzen einen Kontrast zu Höfgens taktischem Karrierekurs.
Juliette Martens
Höfgens prägende Geliebte; die ambivalente private Bindung macht seine Abhängigkeiten sichtbar und spiegelt sein Macht-/Unterwerfungsgeflecht.
Otto Ulrichs
Kollege und Kommunist aus dem linken Theatermilieu. Sein Schicksal markiert die politische Repression – und stellt Höfgens Loyalitätsbruch scharf heraus.
Theophil Marder
Exzentrischer Schriftsteller/Intellektueller aus Höfgens Umfeld. Als unbequeme, eigenständige Stimme verweigert er die Angleichung und kontrastiert Höfgens Opportunismus.
Diese Figuren tragen die zentralen Konfliktlinien: Karriere vs. Verantwortung, Kunst vs. Macht, Anpassung vs. Integrität.
Mephisto – Schlüsselroman
Diese realen Personen inspirierten zu den Romanfiguren in „Mephisto“:
| Reale Person | Position in der realen Welt | Inspiration für Romanfigur | Charakter der Romanfigur |
|---|---|---|---|
| Gustaf Gründgens | Schauspieler, Regisseur, Intendant | Hendrik Höfgen | ein typischer Opportunist seiner Zeit, keine Wertvorstellung, arrogant und machtgierig, wandlungsfähig, skrupellos, jedoch Gewissen vorhanden, ehrgeizig und eitel |
| Hermann Göring | Naziführung | Ministerpräsident | will Prunk zeigen (Uniform und teure Feiern), will gemütlich wirken; typischer Machthaber, grausam |
| Gottfried Benn | Intellektueller; Hofschranze der Naziführung | Benjamin Pelz | Schriftsteller; hasst die Begriffe von Fortschritt und Vernunft, fasziniert von der Grausamkeit der Nazis, genießt als Betrachter den vorzivilisatorischen Überlebenskampf unter ihrem Regime |
| Thomas Mann | liberales Bürgertum | Geheimrat Bruckner | intelligenter Familienpatriarch mit Weitblick |
| Erika Mann | liberales Bürgertum | Barbara Bruckner | intelligent, mitfühlend, geht ihren eigenen Weg, später politische Kämpferin, geht Beziehung und Ehe mit Höfgen ein |
| Klaus Mann | liberales Bürgertum | Sebastian | Barbaras Jugendfreund |
| Pamela Wedekind | Theater | Nicoletta von Niebuhr | Bewunderin Marders (sieht ihn als Vater), künstlerischer Lebensstil, extravertiert |
| Carl Sternheim | Intellektueller | Theophil Marder | verschrobener, äußerst egozentrischer Schriftsteller, der seine beste Zeit als Gegner des Kaiserreiches hatte |
| Max Reinhardt | Theater | Der Professor | Theaterregisseur; besitzt Theater in Wien und Berlin |
| Hans Otto | Schauspieler, Kommunist, Widerstandskämpfer | Otto Ulrichs | Schauspieler, Kommunist, Widerstandskämpfer |
| Andrea Manga Bell | Revueszene, Außenseiterin als Farbige | Juliette Martens | eigenständig, liebt Höfgen, inszeniert im sadomasochistischen Verhältnis zu Höfgen jahrelang seine „Herrin“ |
| Elisabeth Bergner | Theater; Jüdin | Dora Martin | erfolgreiche Schauspielerin (auch im Ausland) |
| Emmy Göring | Theater; Hofschranze der Naziführung | Lotte Lindenthal | geistig weniger gebildet, glaubt, von allen gemocht zu werden (sieht nur das Positive), gläubige Nazine, „Mutter der Nation“ |
| Hanns Johst | Intellektueller; Hofschranze der Naziführung | Cäsar von Muck | Schriftsteller; Speichellecker der Nazis, versucht, ihnen eine intellektuelle Ausstrahlung zu verschaffen |
| André Germain | Diplomat; Berliner Schickeria | Pierre Larue | französischer Botschafter; verehrt das Nazitum als Wiederherstellung des starken und vorwärtsgewandten Deutschen |
| Herbert Ihering | Theater | Ihrig, in späterer Ausgabe Dr. Radig | Theaterkritiker; vormals linker Kritiker der Nazis, seit ihrer Machtübernahme jedoch angepasst |
| Marita Gründgens | Kleinbürgertum | Josy Höfgen | Hendrik Höfgens Schwester; Sängerin, mehrfach verlobt, von einfältigem Wesen |
Mephisto – Aufbau
Erzählstruktur
Mephisto von Klaus Mann ist in Kapitel unterteilt, die die Entwicklung der Hauptfigur Hendrik Höfgen und seine Anpassung an das nationalsozialistische Regime chronologisch darstellen. Die Struktur des Romans folgt einer klaren dramatischen Kurve, die vom Aufstieg Höfgens über seine moralischen Kompromisse bis hin zu seinem inneren Zusammenbruch reicht.
Anfang und Exposition
Der Roman beginnt mit einer Einführung in Höfgens Herkunft und seine frühen Jahre als Schauspieler. Diese Exposition gibt dem Leser einen Einblick in die Persönlichkeit und die anfänglichen Ideale von Höfgen. Es wird deutlich, dass Höfgen von Anfang an von einem starken Karrierewillen und einer gewissen Anpassungsfähigkeit geprägt ist.
Steigende Handlung
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten nimmt die Handlung an Fahrt auf. Höfgens Anpassung an das neue Regime und seine Bereitschaft, moralische Kompromisse einzugehen, bilden die steigende Handlung. In dieser Phase des Romans wird deutlich, wie Höfgen durch seine Opportunismus und seine Fähigkeit, sich dem politischen Klima anzupassen, schnell an Einfluss und Popularität gewinnt.
Höhepunkt
Der Höhepunkt der Handlung ist erreicht, als Höfgen die Rolle des Mephisto in Goethes „Faust“ übernimmt. Diese Rolle ist symbolisch für Höfgens eigenen Pakt mit den Mächtigen des Regimes und markiert den Höhepunkt seiner Karriere. In dieser Phase des Romans wird die Ironie seines Erfolgs deutlich: Während er auf der Bühne den teuflischen Verführer spielt, hat er im wirklichen Leben seine eigene Seele verkauft.
Fallende Handlung
Die fallende Handlung beginnt, als die inneren und äußeren Konflikte Höfgens zunehmen. Seine Beziehungen zu Freunden und Familie zerbrechen, und er beginnt, unter dem psychischen Druck seiner Entscheidungen zu leiden. Diese Phase zeigt die Zerrüttung seiner persönlichen und moralischen Integrität.
Auflösung und Schluss
Der Roman endet mit einer Auflösung, die die vollständige Isolation und innere Leere von Höfgen darstellt. Trotz seines beruflichen Erfolgs ist er letztendlich ein gebrochener Mann, der den Preis für seine Anpassung und seine Kompromisse zahlen muss. Die letzten Kapitel des Romans zeigen Höfgens Verzweiflung und die Konsequenzen seiner Entscheidungen, sowohl für ihn selbst als auch für die Menschen in seiner Umgebung.
Mephisto – Analyse von Sprache und Stil
Sprache
Klaus Manns Sprache in „Mephisto“ ist geprägt von einer klaren, direkten Ausdrucksweise, die die innere Zerrissenheit und den moralischen Verfall der Figuren eindrucksvoll vermittelt. Die Wortwahl ist oft nüchtern und präzise, was den dokumentarischen Charakter des Romans unterstreicht. Mann verwendet häufig ironische und sarkastische Elemente, um die Heuchelei und die Anpassungsbereitschaft der Protagonisten zu entlarven.
Ein besonderes Merkmal ist die symbolische Sprache, die Klaus Mann einsetzt, um die inneren Konflikte der Figuren und die gesellschaftlichen Zustände zu verdeutlichen. Die Figur des Mephisto selbst wird zu einem Symbol für Höfgens moralischen Verfall und seinen Pakt mit den Mächtigen des Regimes.
Stil
Der Erzählstil in „Mephisto“ ist stark von einer kritischen Distanz geprägt. Klaus Mann verwendet einen auktorialen Erzähler, der dem Leser nicht nur die Handlungen der Figuren, sondern auch ihre inneren Gedanken und Motive nahebringt. Diese Erzählweise ermöglicht es dem Autor, das Verhalten der Figuren zu kommentieren und zu bewerten, wodurch die kritische Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus und den darin agierenden Opportunisten deutlich wird.
Mann nutzt zudem intertextuelle Verweise, insbesondere auf Goethes „Faust“, um die Thematik seines Romans zu vertiefen. Die Parallelen zwischen Hendrik Höfgen und der Figur des Mephisto sind zahlreich und werden durch direkte und indirekte Anspielungen auf das klassische Werk verstärkt.
Dialoge
Die Dialoge im Roman sind ein weiteres wichtiges Stilmittel. Sie dienen nicht nur der Charakterzeichnung, sondern auch der Offenlegung der politischen und moralischen Einstellungen der Figuren. Durch die Dialoge werden die Konflikte und die Spannungen zwischen den Charakteren greifbar. Mann setzt Dialoge ein, um die Maskenhaftigkeit und die Verstellungskunst der Figuren zu zeigen, was besonders in den Interaktionen von Höfgen mit den politischen Machthabern und seinen Kollegen deutlich wird.
Metaphern und Symbole
Klaus Manns Gebrauch von Metaphern und Symbolen ist ein zentrales Element seines Stils. Der Titel des Romans selbst, „Mephisto“, ist eine vielschichtige Metapher, die auf Höfgens Rolle als Verführer und Verräter hinweist. Weitere wichtige Symbole sind die Maske und das Theater, die immer wieder auftauchen und auf die Thematik von Schein und Sein hinweisen.
Ironie und Satire
Ironie und Satire sind ebenfalls bedeutende stilistische Mittel in „Mephisto“. Mann benutzt ironische Beschreibungen und satirische Übertreibungen, um die Absurditäten und die moralische Korruption des nationalsozialistischen Systems und derjenigen, die davon profitieren, zu entlarven. Diese Elemente verleihen dem Roman eine scharfe, kritische Note und verstärken die politische Aussagekraft des Werks.
Atmosphäre
Die Atmosphäre des Romans wird durch eine düstere und oft beklemmende Stimmung geprägt. Diese entsteht durch die detaillierten Beschreibungen der politischen Repression und der persönlichen Ängste und Zwänge der Figuren. Mann schafft es, eine Atmosphäre der Bedrohung und des moralischen Verfalls zu erzeugen, die den Leser durch die gesamte Handlung begleitet.
Klaus Manns Sprache und Stil in „Mephisto“ sind wesentlich für die Wirkung des Romans. Sie erlauben es ihm, die Themen Opportunismus, moralische Korruption und die Verführbarkeit des Einzelnen durch totalitäre Systeme eindrucksvoll und nachhaltig zu vermitteln.
Mephisto – Interpretation
Opportunismus und moralischer Verfall
Ein zentrales Thema in Klaus Manns „Mephisto“ ist der Opportunismus und der damit verbundene moralische Verfall. Die Figur des Hendrik Höfgen verkörpert diesen Verfall in einer Weise, die sowohl faszinierend als auch erschreckend ist. Höfgens Karriereaufstieg unter dem nationalsozialistischen Regime wird durch seine Bereitschaft ermöglicht, seine moralischen Prinzipien zu verraten und sich dem politischen System anzupassen. Der Roman stellt die Frage, wie weit ein Individuum bereit ist zu gehen, um persönlichen Erfolg zu erlangen, und welche Kosten dies für die eigene Integrität und die Beziehungen zu anderen hat.
Höfgens Verhalten kann als eine Parabel auf die Anpassung vieler Künstler und Intellektueller an totalitäre Regime verstanden werden. Klaus Mann zeigt, wie der Drang nach Erfolg und Anerkennung einen Menschen dazu bringen kann, seine Ideale zu opfern und sich den Mächtigen anzubiedern. Die Figur des Höfgen dient als Warnung vor den Gefahren des Konformismus und der Komplizenschaft mit autoritären Systemen.
Die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft
Ein weiteres wichtiges Thema in „Mephisto“ ist die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft und seine Verantwortung gegenüber der Wahrheit und der moralischen Integrität. Klaus Mann kritisiert durch die Figur des Höfgen die Neigung von Künstlern, sich aus opportunistischen Gründen politisch zu arrangieren. Der Roman stellt die Frage, ob und inwieweit ein Künstler moralische Verantwortung für sein Handeln und seine Entscheidungen trägt.
Hendrik Höfgen ist ein talentierter Schauspieler, dessen künstlerische Fähigkeiten unbestritten sind. Doch seine Anpassung an das nationalsozialistische Regime und seine Zusammenarbeit mit den Machthabern werfen die Frage auf, ob künstlerischer Erfolg auf Kosten der moralischen Integrität wirklich wertvoll ist. Klaus Mann zeigt durch Höfgens Beispiel, dass wahre Kunst auch eine ethische Dimension haben sollte und dass der Künstler eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und den eigenen moralischen Überzeugungen hat.
Der Pakt mit dem Teufel
Der Titel des Romans „Mephisto“ und die Parallelen zur Figur des Mephistopheles aus Goethes „Faust“ sind nicht zufällig gewählt. Höfgens Karriere und sein Aufstieg zur Macht können als ein Pakt mit dem Teufel interpretiert werden. Wie Faust, der seine Seele an Mephisto verkauft, verkauft Höfgen seine moralische Integrität an das nationalsozialistische Regime, um beruflichen Erfolg zu erlangen.
Dieser Pakt mit dem Teufel symbolisiert die Verführung durch Macht und Erfolg und die Bereitschaft, dafür alles zu opfern. Höfgen wird zur Inkarnation des modernen Mephistopheles, der bereit ist, jegliche moralischen Prinzipien zu verraten, um seine Ziele zu erreichen. Diese Interpretation verstärkt die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Macht und Korruption und zeigt, wie zerstörerisch der Drang nach Erfolg und Anerkennung sein kann.
Gesellschaftskritik und historische Reflexion

Klaus Mann, nachträglich koloriert (frei nach dem schwarzweißen Abbild eines Porträts von Olga Pringsheim, Original verschollen)
„Mephisto“ ist nicht nur eine individuelle Tragödie, sondern auch eine scharfsinnige Gesellschaftskritik. Klaus Mann reflektiert die politische und gesellschaftliche Situation im nationalsozialistischen Deutschland und zeigt die Mechanismen auf, die es dem Regime ermöglichten, die Kontrolle über das kulturelle Leben zu übernehmen. Durch die Figur des Höfgen und sein Umfeld wird die Anpassung und der Verrat vieler Intellektueller und Künstler an das Regime beleuchtet.
Manns Roman kann als eine Warnung vor den Gefahren des Totalitarismus und der Verführung durch Macht verstanden werden. Er zeigt, wie leicht es für ein Regime ist, Menschen zu korrumpieren und sie dazu zu bringen, ihre moralischen Überzeugungen aufzugeben. Die historische Reflexion des Romans macht deutlich, dass die Verführbarkeit und die Anpassungsbereitschaft des Einzelnen in totalitären Systemen immer wiederkehrende Themen der Menschheitsgeschichte sind.
Mephisto – Epoche und historischer Hintergrund
Die Exilliteratur
„Mephisto“ von Klaus Mann ist ein bedeutendes Werk der Exilliteratur, einer Epoche, die durch die Vertreibung und Flucht vieler deutscher Schriftsteller und Intellektueller vor dem nationalsozialistischen Regime geprägt ist. Die Exilliteratur umfasst die Jahre 1933 bis 1945 und ist gekennzeichnet durch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, den politischen Verhältnissen in Deutschland und den Erfahrungen des Exils. Klaus Mann selbst emigrierte 1933 nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten und lebte in verschiedenen Ländern, bevor er sich in den USA niederließ.
Die Werke der Exilliteratur thematisieren häufig die Themen Heimatverlust, Identitätskrise, Verfolgung und Widerstand. Die Autoren dieser Epoche standen vor der Herausforderung, aus der Ferne auf die Ereignisse in Deutschland zu reagieren und ihre literarische Arbeit unter oft schwierigen Bedingungen fortzusetzen. In „Mephisto“ setzt sich Klaus Mann intensiv mit den moralischen und politischen Verwerfungen auseinander, die das nationalsozialistische Regime mit sich brachte.
Historischer Hintergrund
„Mephisto“ wurde 1936 in Amsterdam veröffentlicht, in einer Zeit, in der das nationalsozialistische Regime in Deutschland seine Macht zunehmend festigte und die Repression gegen politische Gegner, Juden und andere Minderheiten verschärfte. Die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen dieser Zeit bilden den Hintergrund des Romans und prägen die Handlung und die Charaktere entscheidend.
Die Weimarer Republik, die der nationalsozialistischen Herrschaft vorausging, war eine Periode großer politischer und sozialer Unsicherheit. Die wirtschaftlichen Krisen und politischen Unruhen dieser Jahre schufen den Nährboden für den Aufstieg der Nationalsozialisten, die 1933 die Macht übernahmen. In diesem Kontext entfaltet sich die Geschichte von Hendrik Höfgen, dessen Karriereaufstieg eng mit den politischen Umwälzungen verbunden ist.
Die politische Anpassung der Kunstszene
Ein zentrales Thema des Romans ist die Anpassung und Kollaboration von Künstlern und Intellektuellen mit dem nationalsozialistischen Regime. Klaus Mann zeigt anhand von Höfgens Karriere, wie viele Künstler ihre Überzeugungen verrieten und sich dem neuen Regime andienten, um ihre berufliche Existenz zu sichern und aufzusteigen. Diese Anpassung war oft mit erheblichen moralischen Kompromissen verbunden und führte zu einem tiefgreifenden Verfall der künstlerischen und intellektuellen Integrität.
Die Kulturpolitik der Nationalsozialisten zielte darauf ab, die Kunst in den Dienst der Propaganda zu stellen. Künstler, die sich nicht anpassten oder offen gegen das Regime opponierten, wurden verfolgt, inhaftiert oder zur Emigration gezwungen. Klaus Mann, der selbst zu den emigrierten Autoren gehörte, verarbeitet in „Mephisto“ seine Beobachtungen und Erfahrungen dieser Zeit und setzt sich kritisch mit der Frage auseinander, wie und warum Menschen ihre moralischen Grundsätze aufgeben.
Zeitgenössische Bezüge
„Mephisto“ enthält zahlreiche zeitgenössische Bezüge und Anspielungen auf reale Personen und Ereignisse. Die Figur des Hendrik Höfgen ist stark an den Schauspieler Gustaf Gründgens angelehnt, der eine erfolgreiche Karriere im nationalsozialistischen Deutschland machte und nach dem Krieg weiter wirkte. Gründgens, der einst ein enger Freund von Klaus Mann war, wurde durch seine Anpassung an das Regime zu einer umstrittenen Persönlichkeit.
Diese Anspielungen und Bezüge verleihen dem Roman eine zusätzliche historische Tiefe und machen ihn zu einem wichtigen Dokument der Zeitgeschichte. Sie zeigen, wie eng die literarische Verarbeitung mit den realen Ereignissen und Personen verknüpft ist und wie literarische Werke zur Reflexion und Kritik der eigenen Zeit beitragen können.
Mephisto – Über den Autor: Klaus Mann
Frühes Leben und Familie
Klaus Mann wurde am 18. November 1906 in München geboren und war der älteste Sohn des berühmten Schriftstellers Thomas Mann und seiner Frau Katja Mann.
Aufgewachsen in einem intellektuellen und künstlerischen Umfeld, zeigte Klaus schon früh eine Begabung für das Schreiben.
Die Familie Mann war eine der prominentesten literarischen Familien Deutschlands, und die Kinder wurden in einem Umfeld erzogen, das von Literatur, Musik und Kultur geprägt war.
Literarischer Beginn
Klaus Mann veröffentlichte seine ersten Texte und Theaterstücke bereits in den 1920er Jahren. Sein erstes Buch, „Der fromme Tanz“, erschien 1925 und ist ein frühes Beispiel für die Thematisierung von Homosexualität in der deutschen Literatur.
Schon früh beschäftigte sich Klaus Mann mit Themen wie Identität, Künstlerdasein und gesellschaftliche Außenseiter.
Sein offenes Eintreten für Homosexualität und seine exzentrische Lebensweise machten ihn zu einer kontroversen Figur in der Weimarer Republik.
Exil und politische Aktivität
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 musste Klaus Mann Deutschland verlassen. Er emigrierte zunächst nach Frankreich, später in die Schweiz und schließlich in die USA. Im Exil engagierte er sich intensiv im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Er schrieb zahlreiche Essays, Artikel und Bücher, in denen er das Regime kritisierte und zum Widerstand aufrief. Zu seinen wichtigsten Werken aus dieser Zeit gehört „Der Vulkan“ (1939), ein Roman über die Erfahrungen der Emigranten.
Sein bekanntestes Werk, „Mephisto“, erschien 1936 in Amsterdam. Der Roman ist eine scharfe Abrechnung mit dem Opportunismus und der moralischen Verkommenheit von Künstlern und Intellektuellen, die sich dem nationalsozialistischen Regime anpassten. Die Figur des Hendrik Höfgen ist dabei stark an den Schauspieler Gustaf Gründgens angelehnt, der einst ein enger Freund von Klaus Mann war. Dieses Buch führte nach dem Krieg zu einem langwierigen Rechtsstreit, da Gründgens‘ Adoptivsohn gegen die Veröffentlichung klagte.
Späteres Leben und Tod
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte Klaus Mann kurzzeitig nach Europa zurück, konnte sich jedoch nicht dauerhaft in Deutschland niederlassen. Seine Jahre im Exil und die ständigen Ortswechsel hatten ihn körperlich und seelisch erschöpft. Zudem litt er unter den Belastungen des Kalten Krieges und der Enttäuschung über die politischen Entwicklungen in der Nachkriegszeit.
Klaus Mann starb am 21. Mai 1949 in Cannes, Frankreich, an einer Überdosis Schlaftabletten. Sein Tod wurde als Suizid interpretiert, was auf seine langjährigen Kämpfe mit Depressionen und seine Enttäuschungen im Exil hinweist. Sein Tod markierte einen tragischen Abschluss eines Lebens, das von künstlerischem Schaffen, politischem Engagement und persönlichen Kämpfen geprägt war.
Wirkung
Klaus Manns Werk ist von großer literarischer und historischer Bedeutung. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Exilliteratur und als scharfsinniger Kritiker des Nationalsozialismus. Seine Bücher, insbesondere „Mephisto“, werden bis heute gelesen und diskutiert und sind ein wichtiges Zeugnis der intellektuellen und künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus und der Verantwortung des Einzelnen in Zeiten politischer Unterdrückung.
Durch seine Werke hat Klaus Mann einen bleibenden Beitrag zur deutschen und internationalen Literatur geleistet. Seine kritische und unnachgiebige Auseinandersetzung mit den Themen seiner Zeit machen ihn zu einem relevanten und einflussreichen Schriftsteller, dessen Werke auch in der heutigen Zeit an Aktualität nichts verloren haben.
Mephisto – Die häufigsten Fragen
Was ist der Roman „Mephisto“?
Mephisto – Roman einer Karriere ist der sechste Roman des Schriftstellers Klaus Mann, der 1936 im Exilverlag Querido in Amsterdam erschienen ist. Der Roman behandelt die Karriere des Schauspielers Hendrik Höfgen im nationalsozialistischen Deutschland und ist eine kritische Auseinandersetzung mit Opportunismus und moralischem Verfall.
Welche Bedeutung hat der Roman „Mephisto“?
„Mephisto“ zählt neben dem Tschaikowsky-Roman Symphonie Pathétique und dem Emigranten-Roman Der Vulkan zu Klaus Manns drei bedeutendsten Romanen. Er wird oft als Schlüsselroman betrachtet, obwohl Klaus Mann dies bestritten hat. Der Roman ist eine scharfe Kritik an der Anpassung von Künstlern an das nationalsozialistische Regime und beleuchtet die moralischen Kompromisse, die damit einhergehen.
Wer ist die Hauptfigur in „Mephisto“ und auf wen basiert sie?
Die Hauptfigur Hendrik Höfgen ist ein talentierter Schauspieler, der sich den Nationalsozialisten anpasst, um seine Karriere voranzutreiben. Höfgen basiert lose auf dem Schauspieler Gustaf Gründgens, der während der Nazi-Zeit großen beruflichen Erfolg hatte und nach dem Krieg weiter wirkte.
Welche realen Personen sind in den Figuren des Romans erkennbar?
Die Romanfiguren in „Mephisto“ haben oft reale Vorbilder:
- Hendrik Höfgen – Gustaf Gründgens
- Otto Ulrichs – Hans Otto
- Juliette Martens – Andrea Manga Bell
- Dora Martin – Elisabeth Bergner
- Nicoletta von Niebuhr – Pamela Wedekind
- Lotte Lindenthal – Emmy Göring
- Barbara Bruckner – Erika Mann
- Geheimrat Bruckner – Thomas Mann
- Ministerpräsident – Hermann Göring
Warum wurde der Roman „Mephisto“ verboten?
Nach dem Tod von Gustaf Gründgens klagte dessen Adoptivsohn Peter Gorski gegen die Publikation des Romans in der Bundesrepublik Deutschland. Das Verbot wurde 1968 vom Bundesgerichtshof bestätigt und durch das Bundesverfassungsgericht in seiner Mephisto-Entscheidung von 1971 bestätigt. Der Grund war der postmortale Persönlichkeitsschutz, der höher bewertet wurde als die Kunstfreiheit.
Wie wurde „Mephisto“ rezipiert und publiziert?
Der Roman erschien 1936 im Exil und wurde 1956 erstmals in der DDR veröffentlicht. In der Bundesrepublik war er aufgrund des Verbotsurteils bis 1981 offiziell nicht verfügbar, konnte jedoch in der DDR erworben oder als Raubdruck bezogen werden. Nach 1981 wurde er trotz des bestehenden Urteils im Rowohlt Verlag publiziert.
Gibt es Verfilmungen oder Dramatisierungen von „Mephisto“?
Ja, „Mephisto“ wurde mehrfach dramatisiert und 1981 verfilmt:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- 1981: Verfilmung von István Szabó mit Klaus Maria Brandauer in der Hauptrolle (Trailer s.o.).
- 1979: Bühnenfassung von Ariane Mnouchkine im Pariser Théâtre du Soleil.
- 1999: Hörspielproduktion von BR Hörspiel und Medienkunst/MDR.
- Weitere Bühnenfassungen folgten in den Jahren 2018 bis 2024 an verschiedenen Theatern.
Was ist der Inhalt von „Mephisto“?
Der Roman erzählt die Geschichte von Hendrik Höfgen von seinen Anfängen im Hamburger Künstlertheater 1926 bis zu seinem Aufstieg als gefeierter Star im nationalsozialistischen Deutschland 1936. Höfgen arrangiert sich mit dem Regime und erkennt zu spät, dass er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, indem er seine moralischen Werte aufgibt und zum „Affen der Macht“ wird.
Wie entstand der Roman „Mephisto“?
Klaus Mann begann die Arbeit an „Mephisto“ 1935 im Exil, inspiriert durch die Karriere seines Schwagers Gustaf Gründgens. Der Schriftsteller Hermann Kesten schlug vor, einen gesellschaftskritischen Roman über einen homosexuellen Karrieristen im Dritten Reich zu schreiben. Der Roman erschien schließlich 1936 ohne homosexuelle Bezüge und fand weltweit Beachtung.
Warum wird „Mephisto“ oft als Schlüsselroman bezeichnet?
Obwohl Klaus Mann betonte, dass „Mephisto“ kein Schlüsselroman sei, wurde er oft als solcher betrachtet, da viele Figuren reale Personen des nationalsozialistischen Deutschland widerspiegeln. Der Roman wurde während seiner Publikation als Vorabdruck in der Pariser Tageszeitung als Schlüsselroman vorgestellt, was zu Missverständnissen führte, die Klaus Mann in einem Telegramm richtigzustellen versuchte.
Leseprobe:
„In den letzten Jahren des Weltkrieges und in den ersten Jahren nach der Novemberrevolution hatte das literarische Theater in Deutschland eine große Konjunktur. Um diese Zeit erging es auch dem Direktor Oskar H. Kroge glänzend, den schwierigen Wirtschaftsverhältnissen zum Trotz.
Er leitete eine Kammerspielbühne in Frankfurt a/M.: in dem engen, stimmungsvoll intimen Kellerraum traf sich die intellektuelle Gesellschaft der Stadt und vor allem eine angeregte, von den Ereignissen aufgewühlte, diskussions- und beifallsfreudige Jugend, wenn es die Neuinszenierung eines Stückes von Wedekind oder Strindberg gab oder eine Uraufführung von Georg Kaiser, Sternheim, Fritz von Unruh, Hasenclever oder Toller.
Oskar H. Kroge, der selbst Essays und hymnische Gedichte schrieb, empfand das Theater als die moralische Anstalt: von der Schaubühne sollte eine neue Generation erzogen werden zu den Idealen, von denen man damals glaubte, daß die Stunde ihrer Erfüllung gekommen sei – zu den Idealen der Freiheit, der Gerechtigkeit, des Friedens.
Oskar H. Kroge war pathetisch, zuversichtlich und naiv. Am Sonntagvormittag, vor der Aufführung eines Stückes von Tolstoi oder von Rabindranath Tagore, hielt er eine Ansprache an seine Gemeinde.
Das Wort »Menschheit« kam häufig vor; den jungen Leuten, die sich im Stehparkett drängten, rief er mit bewegter Stimme zu: »Habet den Mut zu euch selbst, meine Brüder!« – und er erntete Beifallsstürme, da er mit den Schillerworten schloß: »Seid umschlungen, Millionen!«
Oskar H. Kroge war sehr beliebt und angesehen in Frankfurt a/M. und überall dort im Lande, wo man an den kühnen Experimenten eines geistigen Theaters Anteil nahm.
Sein ausdrucksvolles Gesicht mit der hohen, zerfurchten Stirn, der schütteren, grauen Haarmähne und den gutmütigen, gescheiten Augen hinter der Brille mit schmalem Goldrand war häufig zu sehen in den kleinen Revuen der Avantgarde; zuweilen sogar in den großen Illustrierten. Oskar H. Kroge gehörte zu den aktivsten und erfolgreichsten Vorkämpfern des dramatischen Expressionismus.“
Mephisto – Buch
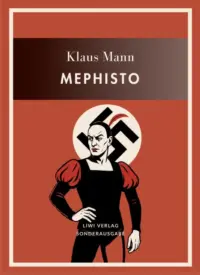 Klaus Mann.
Klaus Mann.
Mephisto.
Roman einer Karriere.
ISBN: 9783753801827
Durchgesehener Neusatz, diese Ausgabe folgt dem Erstdruck:
Querido Verlag N. V. Amsterdam 1936.
Sonderausgabe.
Buch bestellen
(Anzeige / Affiliatelink)*
„Die besten Bücher aller Zeiten“ – Listen zum Stöbern:
- Die besten Bücher aller Zeiten
- 100 Bücher – Die neue ZEIT-Bibliothek der Weltliteratur
- Lieblingsbücher der Briten: BBC Big Read
- Die 100 Bücher des Jahrhunderts von Le Monde
- Der Kanon: Die deutsche Literatur. Reich-Ranickis Liste
- Liste der 100 besten englischsprachigen Romane
- Die besten Bücher von Frauen – Die Kanon – Sybille Berg
- Die besten Bücher 2024
- Liste der 100 besten englischsprachigen Romane
- Die Zeit Bibliothek der 100 Bücher (1980)
- BBC-Auswahl der 100 bedeutendsten britischen Romane
- Schecks Kanon – Die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur
- BBC-Auswahl der 20 besten Romane von 2000 bis 2014
- Elke Heidenreich: Buchtipps & Lieblingsbücher
- Christine Westermann Buchtipps
- Das Literarische Quartett Bücherliste
„Die besten Bücher“ – Auswahl des LIWI Blogs:
- Die besten Bücher von Edgar Allan Poe
- Die besten Bücher von Stefan Zweig
- Die besten Bücher von Fjodor Dostojewski
- Die besten Bücher von Franz Kafka
- Die besten Bücher von Jack London
- Die besten Bücher von Heinrich Heine
- Die besten Bücher von E. T. A. Hoffmann
- Die besten Bücher von Daniel Defoe
- Die besten Bücher von Heinrich Mann
- Die besten Bücher von Joseph Roth
- Die besten Bücher von Rudyard Kipling
- Die besten Bücher von Eduard von Keyserling
- Die besten Bücher von Else Lasker-Schüler
- Die besten Bücher von Arthur Schnitzler
- Die besten Bücher von Gustave Flaubert
- Die besten Bücher von Hans Fallada
- Die besten Bücher von Joseph Conrad
- Die besten Bücher von Novalis
- Die besten historischen Romane
- Die besten Bücher gegen Rechts
- Die besten Bücher für den Sommer
- Die besten Kinderbücher
- Die besten Gedichte von Rainer Maria Rilke
- Die wichtigsten Literaturepochen
- Was ist ein Klassiker?
„Literaturpreis – Gewinner“:
Verfasst von Thomas Löding, LIWI Blog, zuletzt aktualisiert am 03. November 2025